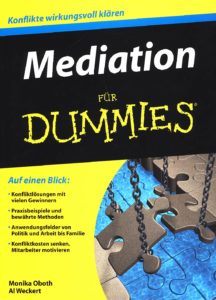Mediation Serie Teil 3: Arbeit mit dem inneren Team
Dritter Teil der Serie rund um Mediation Diplomvolkswirt, Autor und Trainer
Al Weckert beschreibt, was angehende Mediatorlnnen über sich selbst lernen
Veröffentlicht in: Empathische Zeit 4/2017
In einer Mediationsausbildung lernt man mehr als Mediationstechniken. Vor allem lernt man sich selbst im Umgang mit Konflikten besser kennen. Warum zieht Sie das Thema Konfliktklärung an? Was haben Sie bei sich zu Hause über Konfliktklärung gelernt? Worin sind Sie dadurch stark geworden und welche Fettnäpfchen ziehen Sie magisch an? In welcher Rolle gefallen Sie sich und was fürchten Sie bei Auseinandersetzungen? Solchen Fragen widme ich in meinen Ausbildungen ein ganzes Modul. Drei Tage lang geht es um einen Blick auf die Herkunftsfamilie, die eigenen inneren Stimmen, den Umgang mit Projektionen und auf die stabilen Zonen, die wir uns zum Krafttanken schaffen. Bei allen vier Themen pendeln die Teilnehmer zwischen dem Blick auf sich selbst und der Übertragung auf die Mediationssituation hin und her. Die damit verbundenen Entwicklungsschritte sind anspruchsvoll und kräftezehrend. Rückblickend wird das Modul von den Teilnehmern jedoch stets als besonders wertvoll hervorgehoben. Die eigene innere Haltung trägt zum Erfolg einer Mediation letztlich mehr bei als Wissen und Methodik.
In einer Mediation prallen viele unterschiedliche Systeme aufeinander. Denken Sie an die innere Verfassung der Streitparteien, die Beziehung der Streitparteien untereinander, die Erwartungen des Umfelds an die Streitparteien, die Beziehung zwischen Mediator und Streitparteien und das innere System des Mediators. Bei so viel Gruppendynamik hilft es den Ausbildungsteilnehmenden, wenn sie vor dem Ernstfall einen Blick auf die persönliche Biografie, das System der Herkunftsfamilie und die eigenen Muster werfen. Dabei lernen sie, welchen geheimen Mustern sie im Umgang mit Konflikten folgen und wie sie diese steuern können. Außerdem er werben sie wichtiges Grundlagenwisse n über die Entstehung von Rollen und Glaubenssätzen. Genau diese beiden Phänomene sind Dauergäste im Mediationssetting.
Der Blick auf die Herkunftsfamilie
Unser Umgang mit Konflikten wird bereits in der frühsten Kindheit geprägt. Menschen lernen von Vorbildern. Wie sind die Eltern mit Meinungsverschiedenheiten umgegangen? Wie wurden Konflikte zwischen den Geschwistern geklärt? Wie ging es bei Auseinandersetzungen mit der Verwandtschaft zu?
In meinen Ausbildungen zeichnen die Teilnehmer zunächst ein Bild ihrer Familie. An Stelle von Mutter, Vater, Stiefeltern, Geschwistern, Stiefgeschwistern, Onkel, Tanten, Großeltern und der eigenen Person treten Strichmännchen, deren Nasen den Blickwinkel kennzeichnen. Anschließend werden Symbole hinzugefügt, die die Beziehungen untereinander verdeutlichen.
In einer Einzelarbeit fragen sich die Teilnehmer mit Blick auf ihre Zeichnung, welche Rolle sie in dieser Gemengelage eingenommen haben. Waren sie Schlichter? Sind sie geflüchtet? Haben sie jemanden beschützt? Wurden sie unsichtbar? Anschließend gucken sich die Teilnehmer das Verhalten an, das sie in dieser Rolle perfektioniert haben.
Beispiel: In meiner eigenen Herkunftsfamilie standen leider keine Ressourcen zur Verfügung, um die individuellen Identitäten von fünf Kindern anzuerkennen. Es gab klare Rollenerwartungen, deren Nichteinhaltung scharf sanktioniert wurde. Als Anwalt meines Selbst habe ich frühzeitig sprachliche Fähigkeiten perfektioniert, um mich „vor Gericht” zu behaupten.
Während wir bestimmte Muster verinnerlichen, verkümmern in derselben Zeit andere Fähigkeiten. Die Teilnehmer fragen sich deshalb im nächsten Schritt, mit welchen Stärken und Schwächen sie aus ihrer Sozialisierung hervorgegangen sind. Wo liegen die Ressourcen und wo die Lernfelder?
Beispiel: Ich habe gelernt, wie man sich mit starken Argumenten durchsetzt. Als junger Mann haben meine Paarbeziehungen darunter gelitten, dass ich in Konfliktsituationen wenig Einfühlung für meine Partnerinnen aufbringen konnte. Worte wurden zu Mauern. Erst als Dreißigjähriger konnte ich mir die Welt der Gefühle neu erschließen.
Wenn wir die Erkenntnisse über die Muster unserer Herkunftsfamilie auf Mediationssituationen übertragen, wird die besondere Bedeutung dieser Übung sichtbar. In der Herkunftsfamilie von Mediator X hat man sich beim Abendbrot so angeschrien, dass er vor Angst verstummt ist. Wie reagiert er heute bei einer verbalen Eskalation? Angenommen der Vater von Mediatorin Y ist bei Konflikten einfach aufgestanden und gegangen. Wie reagiert sie heute, wenn sich der Vorstandsvorsitzende wütend aus seinem Sessel erhebt?
Entsprechende Situationen werden in Form von Rollenspielen inszeniert, angeschaut und aufgelöst. Das körperliche Er leben spielt eine große Rolle für das Überschreiben alter Muster. Im Rollenspiel erleben wir die Wirksamkeit alter innerer Stimmen und die Entlastung durch neue Verhaltensweisen.
Beispiel: Wenn eine Streitpartei mich in meiner Rolle als Mediator angreift, spüre ich den alten Impuls, mich zu verteidigen. Doch zu welchem Preis? Stattdessen versuche ich heute zunächst, das Anliegen meines Gegenübers zu verstehen. Anschließend horche ich in mich selbst hinein. Was braucht mein Gegenüber? Worauf weist sein Angriff hin? Muss ich mich schützen oder dient diese Information (auf vielleicht unbequeme Art und Weise) dem Mediationsprozess?
Die Arbeit mit inneren Stimmen
In den l990er Jahren hat sich das „Modell der inneren Stimmen” innerhalb der psychosozialen Wissenschaften verbreitet. Man geht heute davon aus, dass das Bewusstsein jedes Menschen viele unterschiedliche Impulse und Denkweisen vereint. Diese werden als innere Stimmen (Bach/Torbet), Teile (Schwartz), Ego-States (Watkins), Selbste (Stone) oder innere Teammitglieder (Schulz von Thun) bezeichnet. Je nach Kontext treten unterschiedliche Stimmen in den Vordergrund. In einem Moment reagieren wir emotional, im nächsten analytisch. Oder wir können gar keine Entscheidung treffen, weil „zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust” (Goethe) .
Bei der Arbeit mit der Herkunftsfamilie sind wir ersten inneren Stimmen begegnet. In meinem Beispiel erzählte ich vom „Verhandlungsprofi”, der seine rhetorische Überlegenheit dafür einsetzt, den Persönlichkeitskern vor vernichtender Kritik zu schützen. Das dazu passende „verdrängte Selbst” ist der „Gefühlsnavigator”, der sensibel in Themen hineinspürt. Jede Hauptstimme hat einen solchen Gegenpart. Auf ihn haben wir häufig den Zugriff verloren. Die meisten Menschen nutzen auf der Klaviatur ihrer inneren Stimmen nur wenige Tasten. Für Mediatoren, die flexibel auf unterschiedliche Menschen und Themen reagieren müssen, ist eine solche Selbstbeschränkung gefährlich. Lüften wir also die Decke unter der sich das Ensemble der inneren Akteure versteckt.
In der Mediationsausbildung stelle ich zunächst diejenigen Stimmen vor, die in der Fachliteratur eine besonders wichtige Rolle spielen: Antreiber und Genussschwein, Beschützer und Abenteurer, Verletzlichkeit und spielerisches Ich etc. Anschließend werden Moderationskarten mit den Namen dieser Stimmen beschriftet. Davon darf sich jeder Teilnehmer eine nehmen. Nun stelle ich Stühle in der Form eines Autobusses auf und bitte die Teilnehmer sich vorzustellen der morgige Tag wäre überraschend frei.
- Auf welchem Platz sitzt welcher meiner inneren Anteile, wenn ich meinen freien Tag dazu nutze, um einen weiteren Artikel für eine Fachzeitschrift zu verfassen? Wer sitzt dann am Steuer, wer wird in den Kofferraum verbannt, wo positionieren sich die anderen?
- An welchen Platz wandern meine inneren Stimmen, wenn ich mich anders entscheide und den Tag in einer Sauna am See verbringe?
- Wer sitzt wo, wenn ich weder schreibe noch sauniere, sondern mit der Familie Freunde besuche?
Nach dieser kleinen Vorübung haben die Teilnehmer die Aufgabe, Ihren eigenen Bus zu ergründen. Welche inneren Stimmen sind ihnen von sich bekannt? Welche dieser Stimmen treten gewöhnlich in den Vordergrund? Welche haben den stärksten Einfluss auf Entscheidungen? Zu jeder inneren Stimme notieren sich die Teilnehmer die Bedürfnisse, denen diese Stimme dient.
Bei der anschließenden Übung vermitteln die Teilnehmer zwischen ihrem inneren Team. Dafür brauchen sie ein Thema, bei dem sie zerrissen oder unentschlossen sind. Mache ich diese und jene Weiterbildung oder nicht? Beende ich meine Liebesbeziehung oder setze ich sie fort? Kaufe ich einen Opel oder einen Ford? Fahre ich in den Urlaub oder baue ich am Haus? Der Falleinbringer stellt sein Thema kurz vor und wählt fünf innere Stimmen aus, die den wahrscheinlich größten Einfluss auf die Entscheidung haben. Die Rollen dieser Stimmen werden von anderen Ausbildungsteilnehmern übernommen. Während einer ca. 45-minütigen Mediation fühlt sich der Falleinbringer in seine inneren Stimmen ein. Er erlebt dabei, wie gegenseitiges Zuhören Fahrt in das Thema bringt.
Auch in der Wirklichkeit repräsentieren Streitparteien häufig die wichtigsten unterschiedlichen Standpunkte zu einem bestimmten Thema. Wie bei der Mediation des inneren Teams gibt es auch dort kein „richtig” und „falsch”, sondern nur unterschiedliche Bedürfnisse. Und wie bei der Mediation des inneren Teams brauchen die Streitparteien Zeit, um verdrängten Anteilen Raum zu gewähren. Doch nur mit dem Blick auf das Ganze finden Gruppen zu einer guten Lösung.
Der Umgang mit Projektionen
Als Projektion bezeichnen wir unbewusste Abwehrmechanismen, bei denen durch Abwertung oder Überhöhung einer Person oder einer Sache von eigenen inneren Konflikten abgelenkt wird. Dem Gesprächspartner werden zum Beispiel ungeliebte eigene Wünsche und Eigenschaften unterstellt, für die wir uns schämen. Die Projektion schützt unser Selbstbild und wehrt Schuldgefühle und Ängste ab.
Beispiele für typische Auslöser von Projektionen:
- Mein Gesprächspartner lebt Dinge aus, die ich mir nicht erlaube.
- Mein Gesprächspartner lebt Dinge aus, die ich mir auch erlaube, aber für die ich mich
- Ich ärgere mich, dass mein Gesprächspartner Dinge kann, die ich nicht kann und um die ich ihn beneide.
Menschen, die einer Projektion folgen, verhalten sich häufig folgendermaßen:
→ Sie werden sehr wütend.
→ Sie ziehen sich (schmollend) zurück.
→ Sie reagieren sehr empört auf Kritik an der eigenen Vorwurfshaltung.
Verräterisch ist die Intensität des Ärgers. Sich selbst in anderen wiederzuerkennen, ist völlig normal. Bei unangemessener Wut liegt jedoch der Verdacht einer Projektion nahe. Je stärker wir reagieren, desto wahrscheinlicher ist der Auslöser mit versteckten eigenen Anteilen verknüpft. Wir reagieren mit Abwertung, um uns zu distanzieren. Oder wir reagieren mit Überhöhung, um die Dinge als weit weg erscheinen zu lassen. Sigmund Freud bezeichnet Projektion deshalb als das „Verfolgen eigener Wünsche in anderen.”
Wie bedeutend Projektionen für unser Leben sind, lässt sich mit einem kleinen Experiment zeigen. Dabei stellen wir uns unseren schlimmsten Feind und dessen Eigenschaften vor. Diese Eigenschaften lassen sich negativ (also mit besonders schlimmen Worten) oder positiv (also bezüglich der darin verbundenen Ressourcen) skalieren. Das Wort egoistisch deutet beispielsweise darauf hin, dass ein Mensch ausschließlich an sich interessiert ist (negative Interpretation) oder sich entschlossen um die Erfüllung seiner Bedürfnisse kümmert (positive Zuschreibung). Wem es schwerfällt, gegenüber anderen für seine Bedürfnisse einzutreten, reagiert auf Egoisten wahrscheinlich besonders allergisch (in Form einer Projektion).
Im Rahmen einer Mediation können sowohl das Mediationsteam als auch die Streitparteien zur Zielscheibe von Projektionen werden. Eine Streitpartei, die sich in der Vergangenheit wenig an Abteilungsmeetings beteiligt hat, könnte zum Beispiel den Vorwurf erheben, dass der Mediator bei der Konfliktklärung zu sehr ins Detail geht. Dabei wiederholt die Streitpartei ihr persönliches Schema. Möglicherweise ist mit dem Vorwurf Angst vor offenem Meinungsaustausch verknüpft. Der Mediator braucht sich in diesem Fall nicht zu verteidigen. Er könnte sich vielmehr fragen, wie der Streitpartei die Angst genommen werden kann.
Tipps für den Umgang mit Projektionen in der Mediation
- Mediieren Sie zu zweit. Projektionen zielen häufig nur auf einen der beiden Mediatoren.
- Holen Sie sich Supervision, wenn sie unsicher sind, ob Sie Zielschreibe einer Projektion sind.
- Sprechen Sie Ihre Eindrücke gegebenenfalls offen gegenüber den Streitparteien an.
Die Suche nach stabilen Zonen
Die Arbeit als Mediator ist erfüllend, aber auch anstrengend. Wer noch nie einen ganzen Tag lang zugehört und vermittelt hat, kann sich nur schwer die Erschöpfung vorstellen, die sich anschließend einstellt. Wer mehrere Tage pro Woche in Konflikten, schwierigen Verhandlungen oder kritischen Mitarbeitergesprächen tätig ist, muss sich vor dem Ausbrennen schützen. Dabei helfen aktive Gesundheitsvorsorge, Regeneration und ein funktionierendes soziales Netzwerk.
Fragen Sie sich regelmäßig, welche Ihrer Hauptbedürfnisse aktuell befriedigt oder vernachlässigt sind. Bei diesem Checkup hilft Ihnen die Arbeit mit den inneren Stimmen. Sie repräsentieren Ihre Hauptbedürfnisse. Jedes Selbst (zum Beispiel der „Verhandler”) ist mit einem oder mehreren Bedürfnissen verknüpft (zum Beispiel „gehört werden” und „Akzeptanz” bzw. „ Empathie”). Die dazugehörige Frage lautet also: Werde ich (als Erwachsener) für meinen Bedarf ausreichend gehört und angenommen? Bekomme ich heute diejenige Empathie, die mir einst gefehlt hat? Falls ja: Wie kann ich diesen Zustand stabilisieren? Falls nein: Wo (bei mir selbst, bei anderen) kann ich die nötige Empathie erhalten? Sicher nicht bei meinen Kunden (den Streitparteien) .
Tankstellen für Regeneration und Stärkung nennt die systemische Organisationsberaterin Roswita Königswieser „stabile Zonen”. Stabile Zonen können eigenständige Prozesse (zum Beispiel Supervision) oder Teil bestehender Prozesse sein (zum Beispiel ein Bürostuhl mit Massagefunktion. Das Königswieser-Konzept mit sechs stabilen Zonen (Ideen, Macht, Menschen, Plätze, Dinge und Organisationen) habe ich um drei zusätzliche Zonen (Körper, Weiterbildung und Rituale) erweitert.
Die Teilnehmer prüfen mit Hilfe einer Checkliste, wie sie bei ihrer Selbstfürsorge mit stabilen Zonen bisher arbeiten. An schließend tauschen sie sich dazu aus, welche nächsten Schritte sie unternehmen möchten, um in ihr körperliches und psychisches Wohlergehen zu investieren.
Auch diese Übung geht über den Blick auf die eigene Stabilität hinaus. In Übertragung auf die Mediationssituation schärfen die Ausbildungsteilnehmer ihren Blick auf die Ressourcen der Streitparteien.
- Welche Fähigkeiten und Stärken helfen den Streitparteien bei der Konfliktklärung?
- Welche Verhaltensweisen haben sich in der Vergangenheit positiv auf die Beziehung ausgewirkt?
- Was können die Streitparteien selbst tun, um Energie für die Konfliktklärung zu tanken?
Fazit
Je mehr Sie über sich und die Entstehung ihrer Muster erfahren, desto leichter fällt Ihnen das Verständnis für die Verhaltensweisen und Glaubensätze anderer. Verwirrende Beziehungsmuster lassen sich einfacher entschlüsseln . Mehr und mehr gelingt Ihnen die Entdramatisierung. Vor allem aber strahlen Sie selbst mehr Ruhe und Gelassenheit aus. Die Quelle dafür ist ein achtsamer und bewusster Umgang mit sich selbst. Dieser beginnt mit Selbsteinfühlung und endet mit Selbstfürsorge.
Mein Newsletter informiert Sie über aktuelle Termine, kommende Workshops und Wissenswertes zu Empathie. Der Newsletter wird ca. 1 mal im Monat ausgesendet, ist kostenlos und kann jederzeit abgemeldet werden.
Interview mit Al Weckert beim Bundesinstitut für Risikobewertung

Gewaltfreie Kommunikation für Dummies